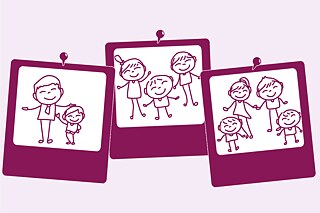„Das Bild der Familie ist bunter geworden“, so der Soziologe Harald Rost, der am Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg arbeitet.
„Familie ist da, wo Kinder sind“, sagt Harald Rost. Ganz gleich, ob die Eltern nun verheiratet sind oder nicht oder ob alleinerziehende Mütter oder Väter den
Familienalltag stemmen.
Der Wandel der Familienformen lässt sich mit Zahlen belegen. Rund acht Millionen Familien mit
minderjährigen Kindern leben nach Daten des Statistischen Bundesamtes in Deutschland. Mehr als 20 Prozent der Mütter und Väter waren im Jahr 2014 alleinerziehend, mehr als zehn Prozent lebten in nichtehelichen Partnerschaften. In den meisten Familien – 69 Prozent – waren die Eltern verheiratet, doch ihre Zahl ist
rückläufig. Das zeigt der Vergleich mit den Daten des Jahres 1996. Der Anteil der Ehepaare lag damals mit 81 Prozent noch deutlich höher. Dagegen gab es sehr viel weniger Familien mit Alleinerziehenden (14 Prozent) und nur halb so viele
Lebensgemeinschaften (5 Prozent).
Alleinerziehende sind zu 90 Prozent Frauen
Auch wenn die Zahlen rückläufig sind: Die meisten Kinder wachsen noch immer in einer klassischen Familie auf: Vater und Mutter, miteinander verheiratet, leben mit ihren gemeinsamen Kindern zusammen.
Klassische Familie
So ist es zum Beispiel bei der zehnjährigen Amelie und ihrer sechsjährigen Schwester Vanessa. Amelies Vater Holger betreibt eine IT-Firma und arbeitet viel. Ihre Mutter Oksana hilft manchmal in der Firma aus, vor allem aber organisiert sie das Familienleben. Sie holt die Mädchen von der Schule ab, fährt sie zum Sport und zum Musikunterricht, kocht und kauft ein.
Alleinerziehende
Familie und Beruf zu vereinbaren ist für Alleinerziehende sehr viel schwieriger als für Ehepaare. Denn Alleinerziehende – und das sind in Deutschland zu 90 Prozent Frauen – müssen sich alleine um Job, Kinder und Haushalt kümmern. „
Knüpft Netzwerke, holt euch Unterstützung von Familie und Freunden“, ist der Tipp von Barbara, die ihren Sohn Laurits allein erzieht und auch die positiven Seiten dieser Lebensform sieht. „So viele Frauen sind enttäuscht von ihren Männern, weil sie abends spät nach Hause kommen, den Schrank nicht reparieren oder
den Abwasch nicht
machen. Ich bin nie enttäuscht von irgendeinem Mann. Denn ich weiß von vornherein, dass ich alles selber mache.“
Mehr Alleinerziehende, weniger klassische Familien. Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Die Gesellschaft verändert sich, und mit ihr die Lebensformen von Familien. Anders als in den vergangenen Jahrzehnten ist es heute selbstverständlich, dass Frauen eine Ausbildung und einen Beruf haben. Sie sind nicht mehr
wirtschaftlich abhängig von Ehemännern.Wenn die Liebe zerbricht, gibt es für die meisten keinen Grund mehr zusammenzubleiben.
So ist die Zahl der
Ehescheidungen in den vergangenen 30 Jahren deutlich gestiegen. Dazu kommt: Einstellungen und Werte haben sich verändert. Viele Paare leben heute ohne
Trauschein zusammen und haben Kinder. Manche halten die Ehe einfach für eine
überholte Einrichtung.
Patchwork: Familien neu gemischt
Auch die hohe
Scheidungsrate in Deutschland trägt zur Vielfalt der Familienformen bei – dann nämlich, wenn aus einer getrennten Familie eine neue Familie wird: die Patchwork-Familie. „Mein Vater hat zwei Söhne mit seiner ersten Frau“, erklärt der 13-jährige Carl. „Nach der Trennung von seiner ersten Frau hat mein Vater dann meine Mutter geheiratet und sie haben zwei Kinder bekommen, meinen Bruder Max und mich.“ Carl und Max verstehen sich prima mit ihren großen Stiefbrüdern. Das ist nicht selbstverständlich. „Wenn eine Familie auseinanderbricht und an beiden Enden neu heilen muss, ist das nie einfach“, sagt Elke, die Mutter von Carl und Max. Ihr Mann Mathias ergänzt: „Bei uns ist dieser Prozess glücklich verlaufen. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Trennung von meiner Ex-Frau
anständig verlief. Wir haben nie ein böses Wort übereinander verloren.“
Patchwork-Familien gab es schon vor 100 Jahren, auch wenn man sie damals Stieffamilien nannte. Darauf weist Harald Rost vom Staatsinstitut für Familienforschung hin:Patchwork-Familie„Stieffamilien entstanden zum Beispiel, wenn eine Mutter bei der Geburt eines Kindes starb, der Vater erneut heiratete und auch mit der neuen Frau wieder Kinder hatte.“ Nach Schätzungen auf der Grundlage repräsentativer Umfragen lebt in Deutschland heute jede zehnte Familie als Patchwork-Familie.
Die Art und Weise, wie Familien zusammenleben, hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert. Verschiedene Familienformen bestehen nach- und nebeneinander, die eine „richtige“ Form gibt es nicht. Ob Kinder glücklich aufwachsen, hängt letztendlich auch nicht von der Familien-Variante ab. Was zählt, sind Liebe,
Fürsorge und Vertrauen. Patchwork-Papa Mathias beschreibt es so: „Familie ist das, was dir Kraft, Rückhalt und Zuversicht gibt. Und manchmal auch den
Tritt in den Hintern, am nächsten Tag wieder aufzustehen und deinen Job zu machen.“